

Brief (Transkript)
Der evangelische Bischof der Kirchenprovinz Sachsen Christoph D. aus Magdeburg an Marianne B. nach West-Berlin im August 1989
Der evangelische Bischof Ende August 1989
der Kirchenprovinz Sachsen
Liebe Schwestern und Brüder! Liebe Freunde!
In dieser Woche werden die meisten aus dem Urlaub zurück sein. Die Schule beginnt. Am letzten Ferienwochenende waren wir in der Kirchenleitung zur planmäßigen Sitzung zusammen. Wir haben lange gesprochen über die politischen Entwicklungen dieser Wochen und Tage. Die Kirchenleitung hat mich gebeten, Ihnen aus diesem Gespräch heraus zu schreiben. Der Brief soll möglichst in Ihren Händen sein, wenn der gewohnte Rhythmus der Arbeit wieder beginnt.
Manche erfahren, daß Freunde, Mitarbeiter und Kollegen fehlen, auch solche, bei denen man nicht darauf gefaßt war. Das „Sommerloch“, von dem in den westlichen Medien gern die Rede ist, war in diesem Jahre reichlich ausgefüllt mit immer neuen Meldungen über „Fluchtwelle aus der DDR“. Es hat mich schon zornig gemacht, zu spüren, wieoft die Kamera oder die Wortwahl der Meldungen geleitet waren vom Hang nach Dramatischem, Sensationellem, scheinbar ohne daß ein Gedanke auf die Auswirkungen verschwendet wurde.
Nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub im fernen Bulgarien kam dann hier die Begegnung mit unseren Zeitungen und Aktueller Kamera. Es kam mir gespenstisch vor: einige bissige Reaktionen auf ausländische Äußerungen in schöner Selbstbestätigung: ‚bei uns ist alles in Ordnung: schuld sind die anderen!‘; kein Wort von dem, was auch zwischen Fremden in der Straßenbahn und der Kaufhalle im Gespräch allgegenwärtig ist, nämlich die besorgte Frage: wo treiben wir hin? Erfolg und Harmonie prägen das Bild. Es gibt gewiß auch ein verantwortungsvolles Schweigen, dieses Schweigen aber zeigt mehr beklemmende Angst. Die Zumutung des Widerspruchs zwischen dem, was der Einzelne im Alltag erfährt und dem, was er in der Zeitung liest, wird unerträglich.
Wo liegt die Wirklichkeit zwischen diesem Bild der Harmonie und des ruhigen Voranschreitens und jener Berichterstattung, die Aufregung und Panik nicht nur widerspiegelt, sondern auch erzeugt? Wo liegt die Wirklichkeit unseres Landes? Können wir sie noch wahrnehmen frei und unverstellt, ohne uns beherrschen zu lassen vom Unwillen über „Berichterstattung“ auf der einen Seite und „unter den Teppich kehren“ auf der anderen Seite?
Wir gehen auf den 40. Jahrestag unserer Republik zu. Von unserer Republik wollen viele gar nicht mehr sprechen. Verdrossenheit und Mißtrauen sind erneut gewachsen. In der Vorbereitung des Jahrestages wird alles überstrahlt werden von dem Stolz, der überall solche Jubiläen begleitet. Die Gefahr wird groß sein, im eigenen Denken und Reden einfach ein Kontrastprogramm aufzulegen und in jeder geplatzten Milchtüte im Bottich des Geschäftes das „wahre Antlitz der Republik“ zu sehen.
Ich wünsche mir – und ich bete darum –, daß wir jeder einzeln und gemeinsam die Freiheit haben, das Gute und das Böse, das Gelungene und das Verdorbene, das Erreichte und das Mißlungene in diesen 40 Jahren zu sehen und zur Sprache zu bringen. Wir brauchen das offene, mutige und streitbare Gespräch über die Wirklichkeit unseres Landes. Denn ohne diese Erkenntnis werden wir die Antwort darauf, wie es weitergehen soll in den nächsten Jahren, nicht finden. Es gibt dieses Gespräch verborgen in Instituten und Organen der SED – davon bin ich überzeugt, auch wenn nur selten Spuren davon zu entdecken sind. Es gibt dieses Gespräch in manchen der Gruppen, die unbequem auffallen und doch dies Land als ihr Land wollen und nicht enttäuscht das Weite suchen. Jeder aber von uns hat das Recht und die Pflicht, an diesem Gespräch teilzunehmen und selbst zu Antworten beizutragen. Das Gute und das Schlechte sehen, unterscheiden zwischen dem, was bleiben soll und dem, was nicht weitergehen darf, das, denke ich, ist nötig, wenn wir auf den 40. Jahrestag zugehen. Doch auch was bleiben soll, wird nur bleiben können, wenn es auf neue Weise angepackt und gesichert wird.
Ich nenne einige Anstöße zum Gespräch:
Bleiben soll die soziale Sicherung der Grundbedürfnisse des Lebens, der Möglichkeit der Arbeit, der Wohnung, der medizinischen Grundversorgung für jedermann. Aber soweit dies durch Subventionspolitik geschieht, ist die Grenze erreicht. Je offener unser Land wird – und das ist notwendig, nicht nur weil wir in der Welt immer mehr zusammenrücken –, um so mehr muß diese soziale Sicherung anders angepackt werden, damit unsere Währung konvertierbar wird, Wasser nicht sinnlos vergeudet und Brot nicht statt Korn verfüttert wird.
Bleiben soll der Vorrang der Friedensverantwortung in der Außenpolitik unseres Landes. Beide deutschen Staaten könnten gemeinsam weitere Impulse vor allem für die konventionelle Abrüstung geben. Aber Frieden und inneres Recht gehören zusammen, wenn Vertrauen wachsen soll. Erweiterung und Sicherung der Rechte des Bürgers sind nötig. Der KSZE-Prozeß kann nicht nur eine Sache der internationalen Beziehungen sein.
Bleiben soll die antifaschistische Verpflichtung unseres Landes. Aber angesichts des überall neu erwachenden Nationalbewußtseins, angesichts der neuen Faszination, die Stärke und Gewalt wieder auf manche Jugendliche ausübt, angesichts der wachsenden Sehnsucht nach markigen Autoritäten, die sagen, wo es lang geht, braucht es mehr als die bloße gewaltsame Unterdrückung solcher Regungen. Die Ausrede, das alles sei Import, dürfen wir uns nicht durchgehen lassen.
Bleiben soll – so denke ich trotz der bedrückenden ökonomischen Schwäche der sozialistischen Länder – das sozialistische Grundgesetz, Lasten und Früchte der Arbeit miteinander zu teilen. Aber die Eigenverantwortung, deren Kraft und Energien die Marktwirtschaft nutzt, muß Raum bekommen und sich auch wirtschaftlich entfalten können. Aber darf man die kaum zügelnde Gewalt verharmlosen, mit der „die unsichtbare Hand des freien Marktes“ die Schwachen immer schwächer und die Starken immer stärker macht – auch und gerade im Miteinander der armen und reichen Länder?
Und was darf auf keinen Fall weitergehen? Nicht weitergehen darf der Widerspruch zwischen veröffentlichter Wirklichkeit und Alltagserfahrungen. Wir brauchen den Mut zur unbequemen Wahrheit bei Regierenden und bei Regierten, ohne Angst vor der Schadenfreude mißgünstiger ausländischer Beobachter, ohne Angst vor dem ungünstigen Licht, in das man bei denen „oben“ kommt. Ohne den Mut zur Wahrheit, die weh tut, wird kein wirkliches Vertrauen wachsen können zwischen Regierenden und Regierten.
Nicht weitergehen darf die Praxis des Umgangs von Staatsorganen mit Bürgern, die die Gewährung von Rechten als Belohnung und Geschenk betrachtet. In unserer Meldestelle der Volkspolizei hängt ein großes Hinweisschild „Zum Genehmigungswesen“. Daran drohen wir zu ersticken. Wir brauchen mehr Rechtssicherheit für jeden einzelnen. Das Vertrauen in die Rechtsorgane ist in den letzten 40 Jahren zu oft beschädigt worden. Es muß wachsen und gepflegt werden. Aber wir müssen auch die neu geschaffenen Möglichkeiten in Anspruch nehmen.
Nicht weitergehen darf die Neigung, ungeplante Initiativen von vornherein mit Mitßtrauen zu betrachten und der besonderen Beobachtung der Sicherheitsorgane zu unterstellen.
Nicht weitergehen darf die Art und Weise, wie wir in unserem Lande mit Fehlern umgehen. Der Anspruch, immer recht zu haben, macht das Eingeständnis von Fehlern fast zu einer Katastrophe. Korrekturen gelten als Schwäche. Wer seine Berufsentscheidung ändert gilt als wankelmütiger Charakter. Aber aus Fehlern kann man lernen. Neue Erkenntnisse schließen kritische Selbsterkenntnis ein. Ich hoffe, daß viele von denen, die jetzt überstürzt unser Land verlassen, zurückkehren können. Daß sie hier wieder Boden finden, ist freilich nicht nur eine administrative Frage. Wie wir als Kollegen oder Freunde ihnen begegnen und ihnen gegenüber mit unserer Enttäuschung oder Neugier oder Schadenfreude umgehen, davon wird es vor allem abhängen.
Ich breche die Aufzählung ab. Die Frage, was bleiben soll und was nicht weitergehen darf, muß ins Gespräch kommen überall und öffentlich.
Lieber Schwestern und Brüder! Wo liegt die Wirklichkeit unseres Landes?
Unser Glaube mischt sich ein. Er ist ja selber Streit um die Wirklichkeit. Denn die Wirklichkeit, die wir bekennen am Beginn jedes Gottesdienstes, ist umstritten und mischt sich ein in die Wirklichkeit dieser Welt: „Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“, d.h. unter der Wirklichkeit seiner Herrschaft steht unser Weg in unserer Kirche, steht der Weg unseres Landes. Oft sehen wir die Spur seiner Herrschaft nicht. Wir beten um sie: dein Reich komme! Wir warten darauf, daß die Wahrheit dieser Wirklichkeit aufleuchtet, wie es verheißen ist: „daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters“. Wir können das ja nur erwarten, wenn wir selbst vor diesem Herrn uns beugen. Wie gut, daß dieser Herr, von dem das gesagt ist, Jesus heißt. Unter seinen Augen dürfen wir um die Wirklichkeit unseres Landes streiten. Da ist kein Anlaß zur Selbstgefälligkeit und Besserwisserei. Da wird auch die unbequeme Wahrheit, die weh tut, zur heilsamen Wohltat. Da braucht man nicht Versteck zu spielen mit der eigenen Erbärmlichkeit, der Erbärmlichkeit unserer Kirche. Aber da gibt es auch Freiheit, konkret zu unterscheiden zwischen dem Guten und dem Schlechten, damit sich alles zum Besseren wendet und wir daran mittun.
Die letzte Augustwoche beginnt. Vor 50 Jahren – so erinnere ich mich dunkel – wurde mein Vater mit nächtlichem Telegramm aus dem Bett geholt: Einberufung! Der Überfall auf Polen lief an. Wir sind hineinverflochten in eine Schuldgeschichte gegenüber und mit anderen Völkern, der wir nicht entkommen. Die Existenz zweier deutscher Staaten gehört in die Folge dieser Geschichte. So kann ich sie annehmen, aber nur mit der Entschlossenheit, daß von deutschem Boden nie wieder Krieg, sondern – wie Erich Honecker als erster hinzugefügt hat – immer nur Frieden ausgeht. Das Nachkriegseuropa ist überraschend in Bewegung gekommen. Das löst nicht nur Hoffnungen und teilnehmende Befürchtungen aus, sondern auch Ängste. Ängste können warnen vor Gefahren, die uns drohen. Die Angst ist sicherlich nicht unbegründet, daß die raschen Entwicklungen in den europäischen Ländern so unübersichtlich werden, daß es zu unbedachten Umbrüchen kommen kann, die den Frieden gefährden. Ängste können aber auch lähmen und zur Erstarrung führen. Ich habe den Eindruck, das ist bei uns der Fall, wenn als höchstes Gut des Landes die Ruhe betrachtet wird. Diese Starre zu durchbrechen, ohne die Gefahren zu verharmlosen, darauf scheint es mir anzukommen, wenn die DDR einen Platz zusammen mit der Bundesrepublik in einem neu sich ordnenden Europa finden soll. Die anderen Völker jedenfalls erwarten, daß wir Deutschen sie nicht erneut mit uns und unseren Problemen belasten. Peinlich ist es, im Auslandsurlaub zu erleben, wie sich andere über uns den Kopf zerbrechen müssen, weil wir zu Hause unsere Probleme nicht lösen, ja sie in der Öffentlichkeit sogar leugnen. Wir brauchen das Gespräch um die Wirklichkeit dieses Landes und wie es weitergehen soll. Jeder hat dazu seine Einsicht und seine Stimme. Das Gespräch kann die Gemeinsamkeit im Leben und Erleben stärken. Schweigen und Resignation führt nur dazu, daß das Mißtrauen wächst, Feindbilder sich verhärten und Illusionen uns irreführen. Ich hoffe, daß uns Mut und Freiheit des Glaubens dabei so leiten, daß andere ermutigt und Ängste überwunden werden.
Das Gebet zu Gott für unser Land, Regierende und Regierte, für unser Reden und Hören wird uns helfen.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr
Christoph D.
der Kirchenprovinz Sachsen
Liebe Schwestern und Brüder! Liebe Freunde!
In dieser Woche werden die meisten aus dem Urlaub zurück sein. Die Schule beginnt. Am letzten Ferienwochenende waren wir in der Kirchenleitung zur planmäßigen Sitzung zusammen. Wir haben lange gesprochen über die politischen Entwicklungen dieser Wochen und Tage. Die Kirchenleitung hat mich gebeten, Ihnen aus diesem Gespräch heraus zu schreiben. Der Brief soll möglichst in Ihren Händen sein, wenn der gewohnte Rhythmus der Arbeit wieder beginnt.
Manche erfahren, daß Freunde, Mitarbeiter und Kollegen fehlen, auch solche, bei denen man nicht darauf gefaßt war. Das „Sommerloch“, von dem in den westlichen Medien gern die Rede ist, war in diesem Jahre reichlich ausgefüllt mit immer neuen Meldungen über „Fluchtwelle aus der DDR“. Es hat mich schon zornig gemacht, zu spüren, wieoft die Kamera oder die Wortwahl der Meldungen geleitet waren vom Hang nach Dramatischem, Sensationellem, scheinbar ohne daß ein Gedanke auf die Auswirkungen verschwendet wurde.
Nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub im fernen Bulgarien kam dann hier die Begegnung mit unseren Zeitungen und Aktueller Kamera. Es kam mir gespenstisch vor: einige bissige Reaktionen auf ausländische Äußerungen in schöner Selbstbestätigung: ‚bei uns ist alles in Ordnung: schuld sind die anderen!‘; kein Wort von dem, was auch zwischen Fremden in der Straßenbahn und der Kaufhalle im Gespräch allgegenwärtig ist, nämlich die besorgte Frage: wo treiben wir hin? Erfolg und Harmonie prägen das Bild. Es gibt gewiß auch ein verantwortungsvolles Schweigen, dieses Schweigen aber zeigt mehr beklemmende Angst. Die Zumutung des Widerspruchs zwischen dem, was der Einzelne im Alltag erfährt und dem, was er in der Zeitung liest, wird unerträglich.
Wo liegt die Wirklichkeit zwischen diesem Bild der Harmonie und des ruhigen Voranschreitens und jener Berichterstattung, die Aufregung und Panik nicht nur widerspiegelt, sondern auch erzeugt? Wo liegt die Wirklichkeit unseres Landes? Können wir sie noch wahrnehmen frei und unverstellt, ohne uns beherrschen zu lassen vom Unwillen über „Berichterstattung“ auf der einen Seite und „unter den Teppich kehren“ auf der anderen Seite?
Wir gehen auf den 40. Jahrestag unserer Republik zu. Von unserer Republik wollen viele gar nicht mehr sprechen. Verdrossenheit und Mißtrauen sind erneut gewachsen. In der Vorbereitung des Jahrestages wird alles überstrahlt werden von dem Stolz, der überall solche Jubiläen begleitet. Die Gefahr wird groß sein, im eigenen Denken und Reden einfach ein Kontrastprogramm aufzulegen und in jeder geplatzten Milchtüte im Bottich des Geschäftes das „wahre Antlitz der Republik“ zu sehen.
Ich wünsche mir – und ich bete darum –, daß wir jeder einzeln und gemeinsam die Freiheit haben, das Gute und das Böse, das Gelungene und das Verdorbene, das Erreichte und das Mißlungene in diesen 40 Jahren zu sehen und zur Sprache zu bringen. Wir brauchen das offene, mutige und streitbare Gespräch über die Wirklichkeit unseres Landes. Denn ohne diese Erkenntnis werden wir die Antwort darauf, wie es weitergehen soll in den nächsten Jahren, nicht finden. Es gibt dieses Gespräch verborgen in Instituten und Organen der SED – davon bin ich überzeugt, auch wenn nur selten Spuren davon zu entdecken sind. Es gibt dieses Gespräch in manchen der Gruppen, die unbequem auffallen und doch dies Land als ihr Land wollen und nicht enttäuscht das Weite suchen. Jeder aber von uns hat das Recht und die Pflicht, an diesem Gespräch teilzunehmen und selbst zu Antworten beizutragen. Das Gute und das Schlechte sehen, unterscheiden zwischen dem, was bleiben soll und dem, was nicht weitergehen darf, das, denke ich, ist nötig, wenn wir auf den 40. Jahrestag zugehen. Doch auch was bleiben soll, wird nur bleiben können, wenn es auf neue Weise angepackt und gesichert wird.
Ich nenne einige Anstöße zum Gespräch:
Bleiben soll die soziale Sicherung der Grundbedürfnisse des Lebens, der Möglichkeit der Arbeit, der Wohnung, der medizinischen Grundversorgung für jedermann. Aber soweit dies durch Subventionspolitik geschieht, ist die Grenze erreicht. Je offener unser Land wird – und das ist notwendig, nicht nur weil wir in der Welt immer mehr zusammenrücken –, um so mehr muß diese soziale Sicherung anders angepackt werden, damit unsere Währung konvertierbar wird, Wasser nicht sinnlos vergeudet und Brot nicht statt Korn verfüttert wird.
Bleiben soll der Vorrang der Friedensverantwortung in der Außenpolitik unseres Landes. Beide deutschen Staaten könnten gemeinsam weitere Impulse vor allem für die konventionelle Abrüstung geben. Aber Frieden und inneres Recht gehören zusammen, wenn Vertrauen wachsen soll. Erweiterung und Sicherung der Rechte des Bürgers sind nötig. Der KSZE-Prozeß kann nicht nur eine Sache der internationalen Beziehungen sein.
Bleiben soll die antifaschistische Verpflichtung unseres Landes. Aber angesichts des überall neu erwachenden Nationalbewußtseins, angesichts der neuen Faszination, die Stärke und Gewalt wieder auf manche Jugendliche ausübt, angesichts der wachsenden Sehnsucht nach markigen Autoritäten, die sagen, wo es lang geht, braucht es mehr als die bloße gewaltsame Unterdrückung solcher Regungen. Die Ausrede, das alles sei Import, dürfen wir uns nicht durchgehen lassen.
Bleiben soll – so denke ich trotz der bedrückenden ökonomischen Schwäche der sozialistischen Länder – das sozialistische Grundgesetz, Lasten und Früchte der Arbeit miteinander zu teilen. Aber die Eigenverantwortung, deren Kraft und Energien die Marktwirtschaft nutzt, muß Raum bekommen und sich auch wirtschaftlich entfalten können. Aber darf man die kaum zügelnde Gewalt verharmlosen, mit der „die unsichtbare Hand des freien Marktes“ die Schwachen immer schwächer und die Starken immer stärker macht – auch und gerade im Miteinander der armen und reichen Länder?
Und was darf auf keinen Fall weitergehen? Nicht weitergehen darf der Widerspruch zwischen veröffentlichter Wirklichkeit und Alltagserfahrungen. Wir brauchen den Mut zur unbequemen Wahrheit bei Regierenden und bei Regierten, ohne Angst vor der Schadenfreude mißgünstiger ausländischer Beobachter, ohne Angst vor dem ungünstigen Licht, in das man bei denen „oben“ kommt. Ohne den Mut zur Wahrheit, die weh tut, wird kein wirkliches Vertrauen wachsen können zwischen Regierenden und Regierten.
Nicht weitergehen darf die Praxis des Umgangs von Staatsorganen mit Bürgern, die die Gewährung von Rechten als Belohnung und Geschenk betrachtet. In unserer Meldestelle der Volkspolizei hängt ein großes Hinweisschild „Zum Genehmigungswesen“. Daran drohen wir zu ersticken. Wir brauchen mehr Rechtssicherheit für jeden einzelnen. Das Vertrauen in die Rechtsorgane ist in den letzten 40 Jahren zu oft beschädigt worden. Es muß wachsen und gepflegt werden. Aber wir müssen auch die neu geschaffenen Möglichkeiten in Anspruch nehmen.
Nicht weitergehen darf die Neigung, ungeplante Initiativen von vornherein mit Mitßtrauen zu betrachten und der besonderen Beobachtung der Sicherheitsorgane zu unterstellen.
Nicht weitergehen darf die Art und Weise, wie wir in unserem Lande mit Fehlern umgehen. Der Anspruch, immer recht zu haben, macht das Eingeständnis von Fehlern fast zu einer Katastrophe. Korrekturen gelten als Schwäche. Wer seine Berufsentscheidung ändert gilt als wankelmütiger Charakter. Aber aus Fehlern kann man lernen. Neue Erkenntnisse schließen kritische Selbsterkenntnis ein. Ich hoffe, daß viele von denen, die jetzt überstürzt unser Land verlassen, zurückkehren können. Daß sie hier wieder Boden finden, ist freilich nicht nur eine administrative Frage. Wie wir als Kollegen oder Freunde ihnen begegnen und ihnen gegenüber mit unserer Enttäuschung oder Neugier oder Schadenfreude umgehen, davon wird es vor allem abhängen.
Ich breche die Aufzählung ab. Die Frage, was bleiben soll und was nicht weitergehen darf, muß ins Gespräch kommen überall und öffentlich.
Lieber Schwestern und Brüder! Wo liegt die Wirklichkeit unseres Landes?
Unser Glaube mischt sich ein. Er ist ja selber Streit um die Wirklichkeit. Denn die Wirklichkeit, die wir bekennen am Beginn jedes Gottesdienstes, ist umstritten und mischt sich ein in die Wirklichkeit dieser Welt: „Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“, d.h. unter der Wirklichkeit seiner Herrschaft steht unser Weg in unserer Kirche, steht der Weg unseres Landes. Oft sehen wir die Spur seiner Herrschaft nicht. Wir beten um sie: dein Reich komme! Wir warten darauf, daß die Wahrheit dieser Wirklichkeit aufleuchtet, wie es verheißen ist: „daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters“. Wir können das ja nur erwarten, wenn wir selbst vor diesem Herrn uns beugen. Wie gut, daß dieser Herr, von dem das gesagt ist, Jesus heißt. Unter seinen Augen dürfen wir um die Wirklichkeit unseres Landes streiten. Da ist kein Anlaß zur Selbstgefälligkeit und Besserwisserei. Da wird auch die unbequeme Wahrheit, die weh tut, zur heilsamen Wohltat. Da braucht man nicht Versteck zu spielen mit der eigenen Erbärmlichkeit, der Erbärmlichkeit unserer Kirche. Aber da gibt es auch Freiheit, konkret zu unterscheiden zwischen dem Guten und dem Schlechten, damit sich alles zum Besseren wendet und wir daran mittun.
Die letzte Augustwoche beginnt. Vor 50 Jahren – so erinnere ich mich dunkel – wurde mein Vater mit nächtlichem Telegramm aus dem Bett geholt: Einberufung! Der Überfall auf Polen lief an. Wir sind hineinverflochten in eine Schuldgeschichte gegenüber und mit anderen Völkern, der wir nicht entkommen. Die Existenz zweier deutscher Staaten gehört in die Folge dieser Geschichte. So kann ich sie annehmen, aber nur mit der Entschlossenheit, daß von deutschem Boden nie wieder Krieg, sondern – wie Erich Honecker als erster hinzugefügt hat – immer nur Frieden ausgeht. Das Nachkriegseuropa ist überraschend in Bewegung gekommen. Das löst nicht nur Hoffnungen und teilnehmende Befürchtungen aus, sondern auch Ängste. Ängste können warnen vor Gefahren, die uns drohen. Die Angst ist sicherlich nicht unbegründet, daß die raschen Entwicklungen in den europäischen Ländern so unübersichtlich werden, daß es zu unbedachten Umbrüchen kommen kann, die den Frieden gefährden. Ängste können aber auch lähmen und zur Erstarrung führen. Ich habe den Eindruck, das ist bei uns der Fall, wenn als höchstes Gut des Landes die Ruhe betrachtet wird. Diese Starre zu durchbrechen, ohne die Gefahren zu verharmlosen, darauf scheint es mir anzukommen, wenn die DDR einen Platz zusammen mit der Bundesrepublik in einem neu sich ordnenden Europa finden soll. Die anderen Völker jedenfalls erwarten, daß wir Deutschen sie nicht erneut mit uns und unseren Problemen belasten. Peinlich ist es, im Auslandsurlaub zu erleben, wie sich andere über uns den Kopf zerbrechen müssen, weil wir zu Hause unsere Probleme nicht lösen, ja sie in der Öffentlichkeit sogar leugnen. Wir brauchen das Gespräch um die Wirklichkeit dieses Landes und wie es weitergehen soll. Jeder hat dazu seine Einsicht und seine Stimme. Das Gespräch kann die Gemeinsamkeit im Leben und Erleben stärken. Schweigen und Resignation führt nur dazu, daß das Mißtrauen wächst, Feindbilder sich verhärten und Illusionen uns irreführen. Ich hoffe, daß uns Mut und Freiheit des Glaubens dabei so leiten, daß andere ermutigt und Ängste überwunden werden.
Das Gebet zu Gott für unser Land, Regierende und Regierte, für unser Reden und Hören wird uns helfen.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr
Christoph D.
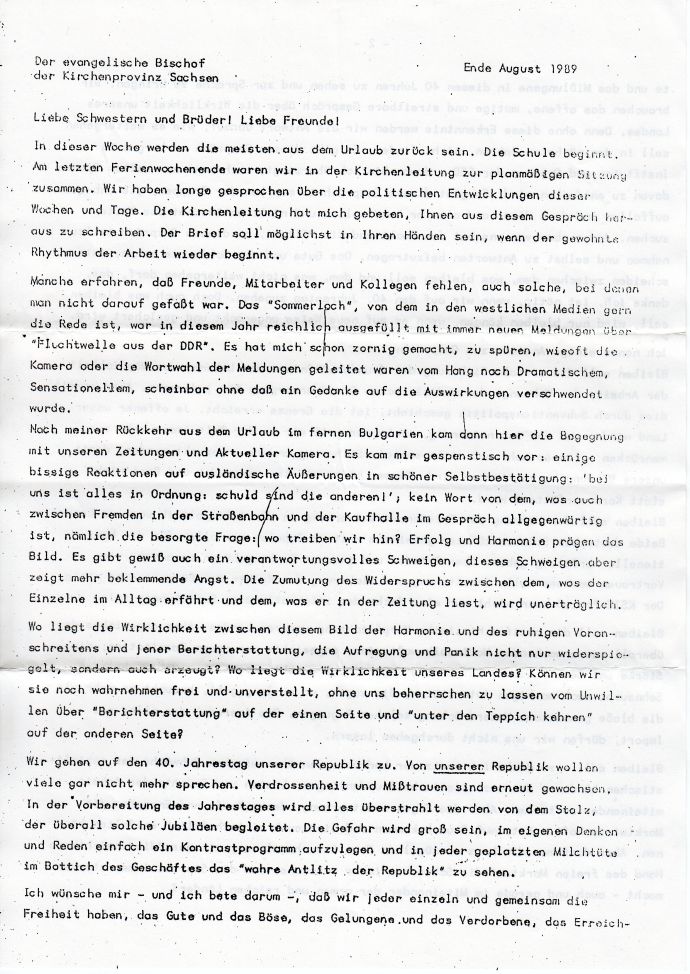
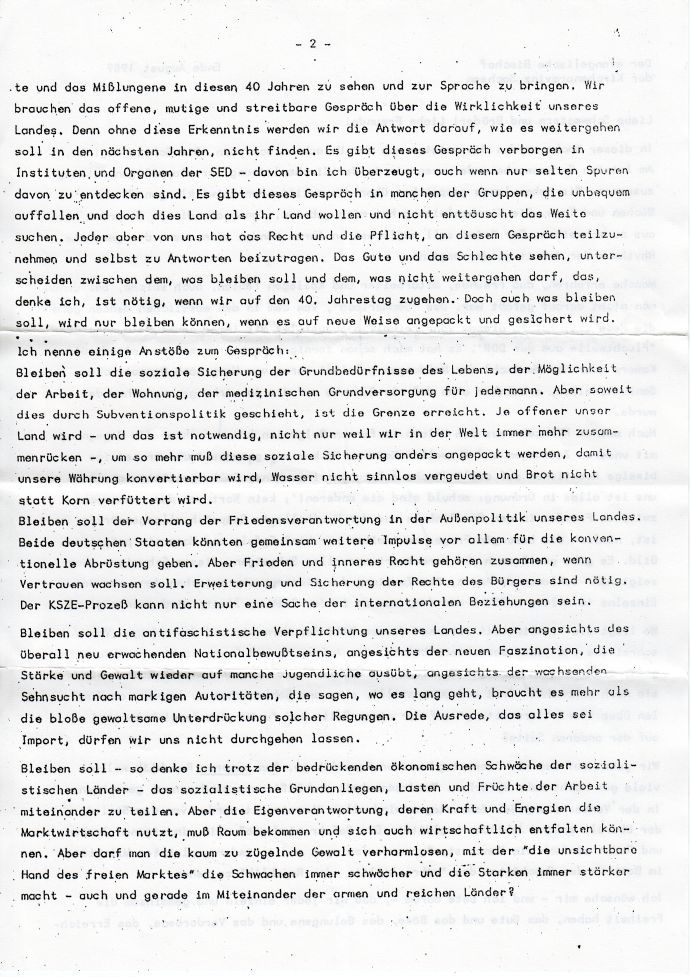
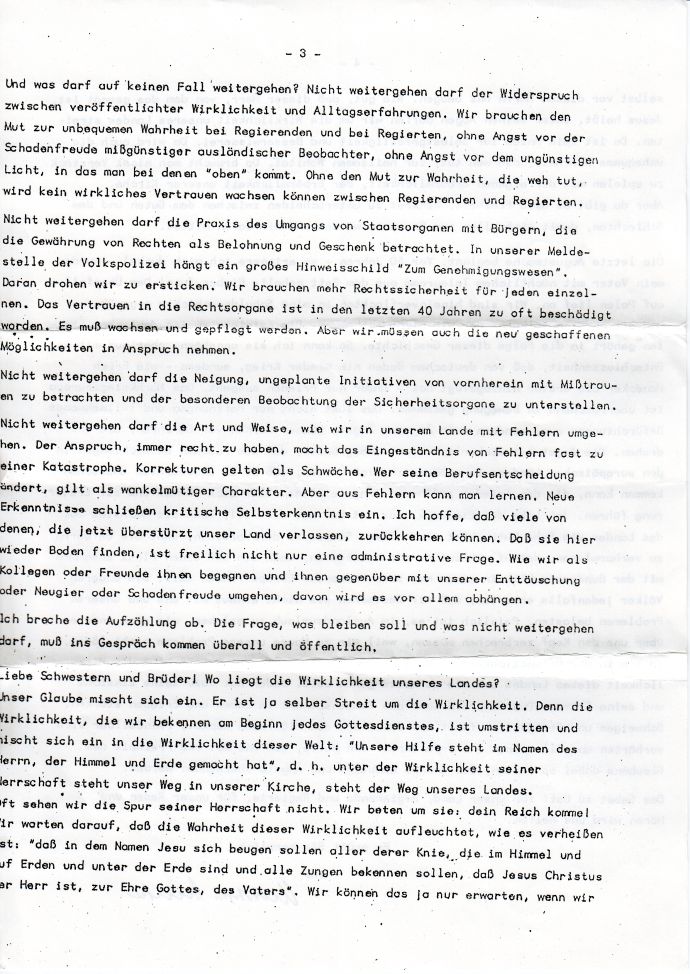
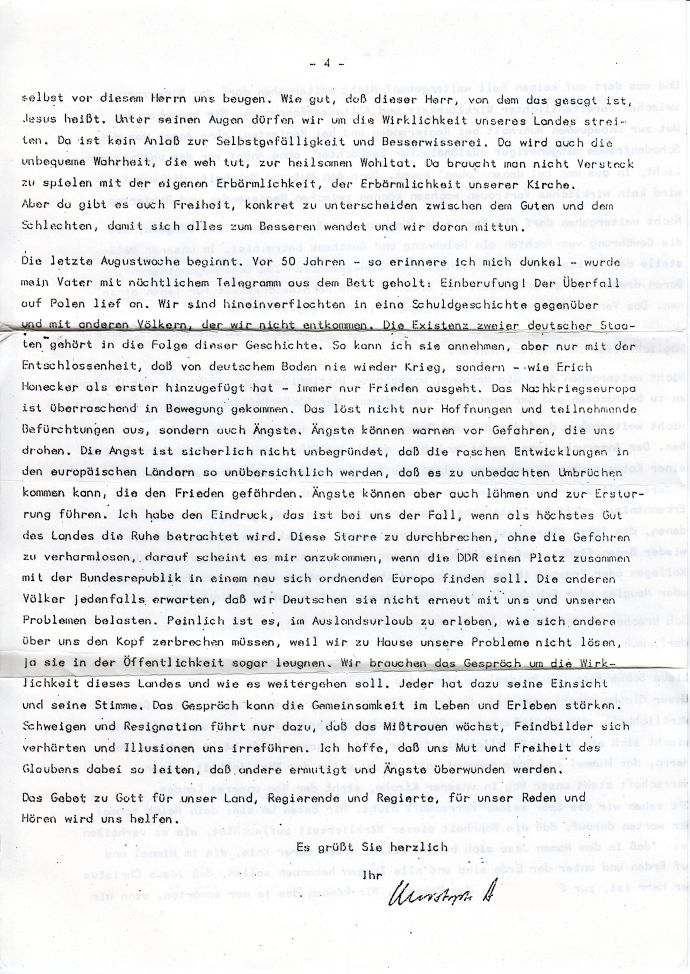
Ansicht des Briefes
Briefe aus diesem Konvolut: